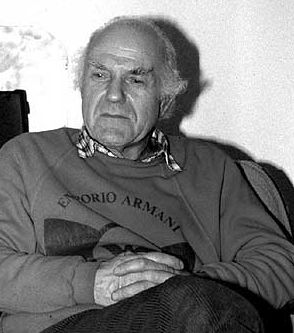Ich zog einen mehrere Meter langen Filmstreifen durch die Steck- und Schaltvorrichtung, der so lang wie die Strecke war, die dieser Filmstreifen zum Projektor und zurück zum Tellerturm zurückzulegen hatte. Der Tellerturm bestand aus drei der Filmteller: unten, Mitte, oben. Auf einen der beiden freien Teller wurde der Plastikring gelegt, der zuvor die große liegende Filmspule innen, denn diese Spule hatte in ihrem Mittelpunkt ein größeres Loch, in das die beschriebene Schaltvorrichtung gesteckt wurde (in die Mitte des Tellers), zusammengehalten hat, die Mitte des Tellers umfassend; der Ring hatte ein paar Steckbolzen an seiner schmalen, kaum zwei Zentimeter breiten Unterseite, die in die Löcher, die rings um das Zentrum des Tellers in diesen eingelassen waren, eingesetzt wurden, so daß der Ring nun festsaß, sich nicht verschieben konnte. An die „Wand“ des Rings legte ich nun den herausgezogenen Anfang des Filmstreifens. Hinter ihm war er schon in den Projektor eingelegt und bewegte dabei den Teller in der Aufwickelrichtung, und dieser sekundenschnelle Vorgang straffte den Filmstreifen, der über Rollen von und zum Tellerturm geführt wurde. Der Film konnte jetzt abgespult und -gespielt werden. Das Telefon klingelte. Ich hob den alten großen Hörer ans linke Ohr. „Warte noch fünf Minuten, draußen stehen sie noch!“, gab der Kinobesitzer knapp durch. So war es ja oft: der Andrang zu den nachmittäglichen Kindervorstellungen – manchmal liefen in diesen Stunden aber auch Erwachsenenfilme, womit nicht gesagt sein soll, daß in die Kindervorstellungen keine Erwachsenen gegangen wären – war so groß, daß Kinder und Eltern noch vor der Kasse standen, wenn die Vorstellung längst hätte beginnen sollen. Ich sah auf die Armbanduhr; gab meistens noch zwei Minuten drauf, aber wenn ich dann keinen zweiten Anruf bekommen hatte, wurde der Diaprojektor eingeschaltet; wenn, wie es nicht selten vorkam, die offizielle Anfangszeit weit überschritten war, ließ ich sofort den Hauptfilm anlaufen. Ich bekam keinen zweiten Anruf, die ersten Dias der verschiedenen werbenden Firmen leuchteten auf der Bildwand im erst halb verdunkelten Saal auf. Die etwa fünfzehn oder zwanzig Dias im runden Dia-Magazin ruckelten nacheinander vor die Linse des Projektors, was nur wenige Minuten beanspruchte. Ich schaltete ab, startete die Maschine, in die das Werbevorprogramm eingelegt war. Das übermannshohe Gerät aktivierte sich mit einem vernehmlichen „Klack!“, surrend lief nun der Filmstreifen aus der oberen in die untere Trommel. Das Vorprogramm war nachmittags kürzer als abends, denn bestimmte Trailer durften den Kindern nicht zugemutet werden. Erst in der ersten Abendvorstellung wurde das Vorprogramm in voller Länge gezeigt; das konnte schon zwanzig oder mehr Minuten dauern. Während nun im „Urania“ die Vorstellung begonnen hatte, ging ich hinüber in den hinteren Teil des Vorführraums, wo, vor der Magenta-Bildwand des „Sternchens“, einer grauen Fläche, auf einem Podest, das fest eingebaut ist, alle Vorführeinrichtungen für dieses Kino stehen: Tellerturm, Projektor (ein Phillips-Gerät neuerer Bauweise) mit angeflanschtem 16-mm-Projektor, ein rechteckiger Spiegel etwas im Hintergrund der nicht breiten Bühne, auf den das vom Projektor spiegelverkehrt ausgegebene Bild fiel, und der Spiegel ist so installiert, daß das ganze Bild, nun wieder seitenrichtig, ohne Winkelverzerrungen von hinten auf die Magenta-Bildwand geworfen wird. Bevor ich die Vorstellung im unteren Kino begann, hatte ich schon, nachdem die Filme für’s große Kino betriebsbereit gewesen waren, auf dieser Bühne gestanden und die prinzipiell gleichen Hand-, Arm- und Körperbewegungen ausgeführt, die für das Einlegen des Films des „Sternchens“ notwendig gewesen waren, auch wenn hier nur mit einem Projektor vorgeführt wird, was bedeutet, daß der vorderste Teil des Filmstreifens ein Stück weit ohne Projektion durch die Maschine abgespult wird, vor der Vorstellung „vorläuft“ – der Vorprogrammsteil, dessen Einzelfilmchen das zeigen, was anwesende Kinderaugen nicht sehen sollen. Nun, da die Vorstellung im „Sternchen“ ohne Zeitverzögerung begonnen werden kann, lasse ich rasch noch die Jalousie vor dem Vorführraumfenster hinunter, trete seitlich an den Projektor heran, drücke den Startknopf, den ich mit ausgestrecktem Arm von unten erreiche; der Film läuft vom oberen Teller durch die Maschine, wiederum von an der Decke befestigten Rollen geführt, zum mittleren Teller; zwei Filmbahnen, eine oben, eine unten, queren den kleinen Raum. Ach ja: Zwischendurch, in der Zeit, die mir noch vor dem Beginn der beiden 15.30 Uhr-Vorstellungen geblieben war, war ich hinuntergegangen, hatte ich mich durch das Gedränge der Kinder und Eltern, das im Foyer geherrscht hatte, selbst gedrängt, in den Gang hinein, der zwischen den Kinos „Urania“ und „Stardust“ (dessen Einweihungstag, der 15. März 1981, auch den Beginn meiner Angestelltenzeit markiert hatte) liegt, zum Vorführraum hinter dem „Stardust“-Kino (dessen Einweihungsfilm übrigens der Woody Allen-Film „Stardust Memories“ gewesen war), wo ich die schwere Metalltür geöffnet und den Raum betreten hatte, vier kleine schmale Treppenstufen hinaufgegangen war und die wieder im Prinzip gleichen Finger-, Arm- und übrigen Körperdrehungen und -renkungen, die aber, aufgrund der verschiedenen Steh- und Bewegungsflächen, die zur Verfügung standen, in jedem Kino etwas anders ausfielen, getan hatte, um sofort wieder hinauf in den oberen Vorführraum zu eilen, um dort den vielleicht nur angefangenen Vorgang des Filmeinlegens fortzusetzen; oder ich hatte um 15.15 Uhr sogleich nach den Abspielvorbereitungen – vorausgesetzt, Kinobesucher hatten inzwischen im „Stardust“-Saal gesessen – den Projektor anlaufen lassen; in diesem Fall hatte der „Stardust“-Film also angefangen, als ich oben noch mit den Vorkehrungen für einen gelungenen Filmbetrieb beschäftigt war. Ein paar Minuten später liefen dann alle Filme, und während sich die Kinogänger an den Filmgeschichten erfreuten, hatte ich mich nun ins Foyer und in den Kassenraum zu begeben, denn der Getränkeautomat, der an einer Foyerwand stand, als auch der Bestand an den viele Sorten umfassenden Süßwaren, die die Kassiererin verkaufte, mußte aufgefüllt werden. Das Lager für das Bier und die Limonaden und die Süßwaren befand sich im Keller des „Filmtheaters“ (so dürfte es noch immer sein), und im Kassenraum dieses Kinos waren ebenfalls Süßwarenkartons aufgestapelt. Ich wuchtete die mit den leeren Flaschen, die am Abend zuvor nach der Nachtvorstellung im „Urania“ und „Stardust“ eingefüllt worden waren, inzwischen vollen Bier- und Limonadenkästen auf einen Sackkarren, den ich aus dem Anbau an der dem Hof zugewandten Seite des „Filmtheaters“ geholt hatte, und transportierte die oft drei oder vier Kästen über den Hof zwischen den Kinogebäuden und hatte auch den Zettel in der Tasche, auf den die Kassiererin die Bezeichnungen der zu besorgenden Süßwaren geschrieben hatte. Regen fiel, Schnee sank nieder, die Sonne hockte prall mit Photonen gefüllt am Himmel, oder graue Wolkenreservoire, die ihre Wasservorräte noch nicht ausgaben, zogen drohend über die Dachfirste – ich schob, Tag für Tag oder Abend für Abend, den Sackkarren über den Hof, stellte ihn vor den Türen des „Filmtheaters“ ab, hievte den obersten Kasten empor, betrat das Kinofoyer und ging nach links zur Kellertür hinter dem kurzen Tresen für den Süßwarenverkauf, öffnete diese Tür (oder sie stand schon offen), trug den Kasten die Steintreppe hinab, sortierte dort aus dem Kasten die Flaschen der jeweiligen Getränkesorten in die verschiedenen leeren Sortenkästen, die, dann gefüllt, auf den Abtransport durch den Getränkelieferanten harrten; sofern Getränkekästen harren können. Ich nahm einen vollen Kasten vom Sackkarren vor der Tür, oder, so war de facto mein Umgang mit den Kästen, ich hatte schon die leeren vom Karren genommen und im Foyer vorerst abgestellt, hatte den Karren ins Haus gezogen, alle Kästen dann hinunter getragen, ehe ich volle Kästen hinauf schleppte. Während ich leere und volle Kästen umher trug, stellten die beiden Damen, die an diesem Sonntag als Kassiererin und Platzanweiserin Dienst taten, im Kassenraum das Sortiment, das zum Verkauf in der „Urania“-Kasse, in der auch die Eintrittskarten für’s „Stardust“ und „Sternchen“ zu haben waren, benötigt wurde, in Schachteln zusammen. War dies getan, gab’s Kaffee, vor allem dann, wenn die Damen Villemain und Geister in Kasse und Kino zu tun hatten. Frau V., mittelgroß, im Jahr 1992 schon jenseits des sechzigsten Lebensjahrs, arbeitete seit dem Ende der fünfziger Jahre im Filmtheaterbetrieb K., allerdings nicht jeden Tag, eine Schwäbin, die in der Karpfengasse wohnte, auch zu der Zeit, in der die WG in der Nummer 24 existiert hatte, wir kannten uns aber in jener Zeit noch nicht; in den Wochen und Monaten, in denen das „Schützentheater“ ein neues Stück einprobierte und während und nach dem „Schützenfest“ spielte, war sie als vieljährige und langerprobte Garderobiere hinter den Kulissen tätig. Im Kino war sie als Platzanweiserin nicht wegzudenken. Frau G. hatte in der Mitte der achtziger Jahre als Kassiererin begonnen; eine krebskranke, tapfere und willensstarke Frau, immer zu einem flotten Sprüchlein aufgelegt, mittleren Alters, als sie mit dieser Arbeit begonnen hatte, die sich ohne zu klagen von Jahr zu Jahr durch’s Leben kämpfte; im Sommer dieses Jahres 2002 starb sie. Mit beiden Damen pflegte ich gutes Einvernehmen; und nicht nur sonntags gab‘s von ihnen Kaffee und Kuchen, die kleine Labsal zwischendurch. Beides verzehrte ich im Stehen in dem mit einer sehr alten Sitzgruppe, Schränken und Türmen aus Süßwarenkartons vollgestellten Kassenraum, wobei Tasse und Teller eben auf einem der niedrigeren Kartonstapel an der Wand plaziert waren. Dann dankte ich für diese Gaben und begann Kästen und Kartons, der Sackkarren stand wieder vor dem Haus, hinauszutragen und aufzuladen, bis obenhin, fast immer. Langsam schob ich den Karren jetzt in die andere Richtung. Unten vor der Treppe zum „Urania“-Foyer blieb er stehen, bis ich Kartons und Kästen hinein getragen hatte, die vollen Flaschen in den Getränkeautomat eingestapelt hatte, dann rollte ich ihn zum Abstellraum, wo er bis zum nächsten Einsatz, an manchen Tagen noch ein zweites Mal an einem Abend, stand. Nun endeten die Filmvorstellungen auch schon bald, die Filme, die Projektoren, mußten rechtzeitig abgeschaltet werden, wenn der Nachspann durchgelaufen war; oft war ich nun der Vorführer, der die Vorhänge, verbunden mit den seit-lichen Blenden, schon über die Bildwand schickte, wenn die Titel noch nicht ganz von unten nach oben verschwunden waren und der das Licht schon aufglimmen ließ. Die Prozeduren der Vorbereitungen für die nächste Vorstellung wiederholten sich, und für die letzte Vorstellung um 20.30 Uhr, wenn die Anfangszeiten wegen „Überlänge“-Filmen (aber in den Neunzigern sprach man kaum noch von „Überlänge“, ein Film dauerte eben so lange, wie er dauerte) nicht sowieso andere waren, noch einmal. Zwischendurch, während die Filme liefen, waren Schaufensterdekorationen zu erledigen, andere Filmbilder, auch -plakate, waren an den Aushangflächen, auch sonntags, anzubringen, auch das, was in den Innenschaukästen hing, mußte häufig ausgetauscht werden, und die Anfangszeiten, die der Kinobesitzer in fast jeder Woche frisch auf bunte kleinformatige Zettel schrieb – und manchmal dauerte es, bis er das tat, und dann wollte er nicht glauben, daß eben diese doch eigentlich so häufig gebrauchten steifpapierenen Anfangszeiten-Zettel, nicht vorhanden sein sollten, und warum er schon wieder neue schreiben müsse? Und nur Anfangszeichen in seiner Schrift galten, obwohl auch ich dann und wann, wenn er auf Reisen war, und das war er sehr oft, welche schrieb. Doch nur die von ihm geschriebenen Anfangszeiten-Zettel waren die einzig vorzeigbaren. Diese Anfangszeiten, ein Wort, das in fast schon absurd klingender Häufigkeit gebraucht wurde, mußten, da es ja unter der Woche keine Nachmittagsvorstellungen gab, außer in den Schulferien, unermüdlich ausgewechselt werden. Während die Filme liefen, machte ich – im Foyer fertig geworden – oben im Vorführraum einen Film spielfertig, der ein paar Tage später eingesetzt wurde. Auf dem Umroller sah ich mir den ganzen Film, Meter für Meter, nach Schäden an, die zu Vorführunterbrechungen führen konnten. Der Umroller bestand aus zwei gedrungenen Metallstäben, die auf der dunklen Platte des Holzarbeitstisches festgeschraubt waren (oder sind), auf die die Filmspulen von „hinten“ draufgesteckt wurden. Am rechten Stab hing eine Kurbel, die gedreht wurde; so wurde der Film, Akt für Akt, von der linken Spule zur rechten umgekurbelt und mit den Fingern der linken Hand fühlten die Vorführer, denn es gab außer mir noch einen Aushilfsvorführer, ob der Filmstreifen Risse und Perforationsschäden aufwies. Wie oft reparierte ich stundenlang solche Filmschäden mit dem klobigen Klebegerät! Legte ich kurze Tesafilmbahnen über die Breite des Streifens, korrigierte ich falsch zusammengeklebte Filmstreifen, die, unbehandelt, während der Vorführung den „Bildstand“ verändert hätten, die Köpfe der Schauspieler beispielsweise in irgendwelche Regionen oberhalb der Bildwand versetzt hätten, oder die, auch das kam bei falschem „Bildstand“ vor, ohne Beine gewesen wären; die dann nur als Torsi agiert hätten; und quer über die Handlung verlief dann ein Balken, das war der auf dem Filmstreifen nur sehr dünne Strich, der ein Bild vom anderen trennte; der Bildstrich. Aber freilich: manchmal übersah ich solche Fehler auf der Filmbahn (und nicht nur ich). Dann hieß es, bis zur nächsten Vorstellung möglichst nachzubessern, oder zu einer bestimmten Sekunde neben den Projektor zu stehen und mit einer schnellen Regulierung das Bild hinauf- oder hinabzuziehen, so daß das ganze Bild wieder richtig „stand“. So vergingen die Sonntage, und nicht nur sie, bis alle Vorstellungen beendet waren und die Kinos abgeschlossen wurden; auch das besorgte ich über viele Jahre hinweg, nachdem ich als letzter Kontrolletti durch die Kinosäle gewandert war, abgeschlossene Saaltüren und verlassene Toiletten nachgeprüft hatte. Die Notbeleuchtungen schaltete ich im Vorführraum aus. Die Gleichrichterelektrik auch – endlich erstarb das beständige tiefe Brummen im Vorführraum, eine etwas unwirkliche Stille breitete sich zu dieser Minute der Nacht aus, nach dem Getöse, das seit dem Nach-mittag kontinuierlich vorhanden gewesen war. Die Damen im „Sternchen“ räumten noch eine ganze Weile lang auf, rechneten ab, und war A.K. außer Haus, so wartete ich, bis auch sie fertig waren; gemeinsam verließen wir das Gebäude durch den Privateingang, auch ihn schloß ich ab. Im Hof stand dann nur noch das Auto der „Sternchen“-Dame, und wenn ich sie brav bat (sehr oft tat ich das), fuhr sie mich vor den Wohnblock am Klauflügelweg.
- Vormittags bedeckt, nachmittags sonnig, aber kalt. Schöne Westabenddämmerung über der Stadt; rote Sonne.
10.11.2002
10.11.