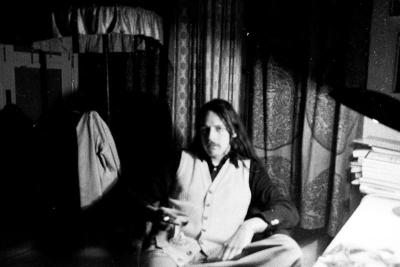5.11.2002
Erst nach dem Tod der Mutter der Geschwister Leupolz, der zu ihr trat, als sie in ihren Achtzigern lebte, nach dem Beginn der achtziger Jahre des Jahrhunderts, das doch die meisten Toten produzierte, und dieses technische Wort dürfte, eingedenk des fabrikhaften Tötens, angebracht sein, aber das auch allgemein, bevölkerungs- und mortalitätsstatistisch betrachtet, bisher in der Menschengeschichte die meisten Toten gehabt hatte, weil mehr Lebende als jemals zuvor auf der Erde sich fragten, wozu sie da seien, begann allmählich ein anderes Ritual, ein gesellschaftlicheres, denn als Klaus L. die Zweizimmerwohnung im obersten, im dritten Stockwerk des geerbten Hauses bezogen hatte (das zweite Zimmer war kaum der Erwähnung wert, so winzig war es), trafen wir, die Freundesgruppe, uns mit einiger Regelmäßigkeit jeweils an den Montag Aenden bei Klaus L., und daß das Anfang der Wochen, am ereignislosesten Tag der Woche, wie der Montag sich eben in Biberach darstellte, geschah, lag daran, daß ich über das ganze Jahrzehnt der Achtziger bis zur Mitte der Neunziger nur an diesem Tag nicht zur Kinoarbeit mußte; aber es gab während meiner Kinozeit auch Phasen, in denen ich selbst am mir zustehenden freien Tag Filme vorführte, freiwillig, weil ich dadurch zu ein paar Mark mehr kam; es war im Jahr 1984, und um das zu verifizieren müßte ich in die Akten sehen, als ich, weil der „Montagsvorführer“, der gelegentlich auch, doch sehr selten, an anderen Tagen, Abenden, einsprang, den Job an den Nagel gehängt hatte und ein Nachfolger sich anscheinend nicht so schnell finden ließ, ein Vierteljahr ohne einen einzigen freien Abend durcharbeitete. Ohnehin fand mein Privatleben, sofern ich davon sprechen konnte, erst nachts statt. Schon vor den Filmvorführerjahren hatte ich die Nacht zu meinem Tag gemacht. An den Abenden der Montage kam der „kleine Kreis“ zusammen, zu dessen Teilnehmern außer dem Gastgeber L. die Herren Thomas G., Jürgen K., Mario K., hin und wieder, gegen Ende der Achtziger, auch Christoph H., als wir noch miteinander befreundet waren, gehörten, und andere, deren Namen mir augenblicklich schon entfallen sind, die aber nie immer alle zusammen sich einfanden, dazu ab und zu Damen unterschiedlichen Alters, die, sei es, weil sie seit längerem Zugang zum „kleinen Kreis“ hatten, zu dem sich hin und wieder andere jüngere und ältere Herren für einen Abend dazugesellten, die aber auch nur selten erschienen, oder, weil sie zum Bekanntenkreis eines der Teilnehmenden zählten und zufällig im „Tweety“ um die Ecke gesessen hatten und eingeladen wurden, nach dem spätabendlichen Kneipenaufenthalt noch zum Plaudern und Trinken in die Leupolz’sche Wohnung mitzukommen, anwesend waren. Es war eine (heterosexuelle) Männerrunde, ein mal wirklich nur „kleiner Kreis“, der oftmals auch nur aus Klaus L. und mir bestand, oder es war auch so, daß dann, als L. und ich schon seit einer oder zwei Stunden bei billigem Wein miteinander unsere Gespräche geführt hatten, noch andere „eingeführte“ Mitglieder unseres Montagstreffens, unseres „Jour fixe“, später eintrafen, oder ein andermal größeres Zusammenkommen sich ergab, je nachdem, wie Lust und Laune dazu verhanden waren; auch, um das nicht zu vergessen, in den zur Nacht gewordenen Abenden von Freitagen zu Samstagen; aber ich war dann so gut wie nie dabei, denn bis ich aus dem Kino herauskam, waren diese freundschaftlichen Zusammenkünfte wieder beendet. Alternierend zu L.s Gastfreundschaft lud ich den „kleinen Kreis“ immer mal wieder zu mir in das Apartment im fünften Stock ein; auch dann wurde es, bei Bier, Wein, Whisky, Zigaretten, stets sehr spät, und Thomas G., einer meiner nicht schwulen längstjährigen Freunde, der zu jener Zeit auswärts studierte, fuhr schließlich Klaus L. hinunter vor das Haus in der Justinus-Heinrich-Knecht-Straße und danach Richtung Nordwesten zu seinem Studienort in Baden-Württemberg. Dieses rituelle Treffen verlor erst Mitte der neunziger Jahre an Bedeutung; als nach fast zehn Jahren das Bedürfnis nach Zusammenkunft und Austausch sich erschöpft hatte und auch die Freundesbeziehungen sich zum einen oder anderen gelockert hatten oder gar fast abgebrochen waren. Eine Stimmung, oder Nichtstimmung, der Langeweile war über den „kleinen Kreis“ gefallen, und es gab zwar noch die Montagabende, aber nur Klaus L, Thomas G. und ich hockten, bei L. oder mir, noch zusammen, aus alter Gewohnheit. Ich hatte inzwischen Alkohol und Zigaretten ja aufgegeben, und auch das Kneipengehen machte mir nun kaum noch Vergnügen. Zwanzig Jahre lang hatte ich es exzessiv gepflogen. Als Klaus Leupolz im Januar 1996 tödlich erkrankt war, war es aus mit diesem Ritual, das so viele Jahre praktiziert worden war.
- Kalt, ab dem Mittag sonnig; um 16.45 Uhr ein langer rosafarbener Strich, ein Kondensstreifen eines Flugzeugs, quer über die „Linden“ im graublau abfärbenden Himmel über Berlin.
5.11.2002
- Kalt, ab dem Mittag sonnig; um 16.45 Uhr ein langer rosafarbener Strich, ein Kondensstreifen eines Flugzeugs, quer über die „Linden“ im graublau abfärbenden Himmel über Berlin.
5.11.2002
05.11.